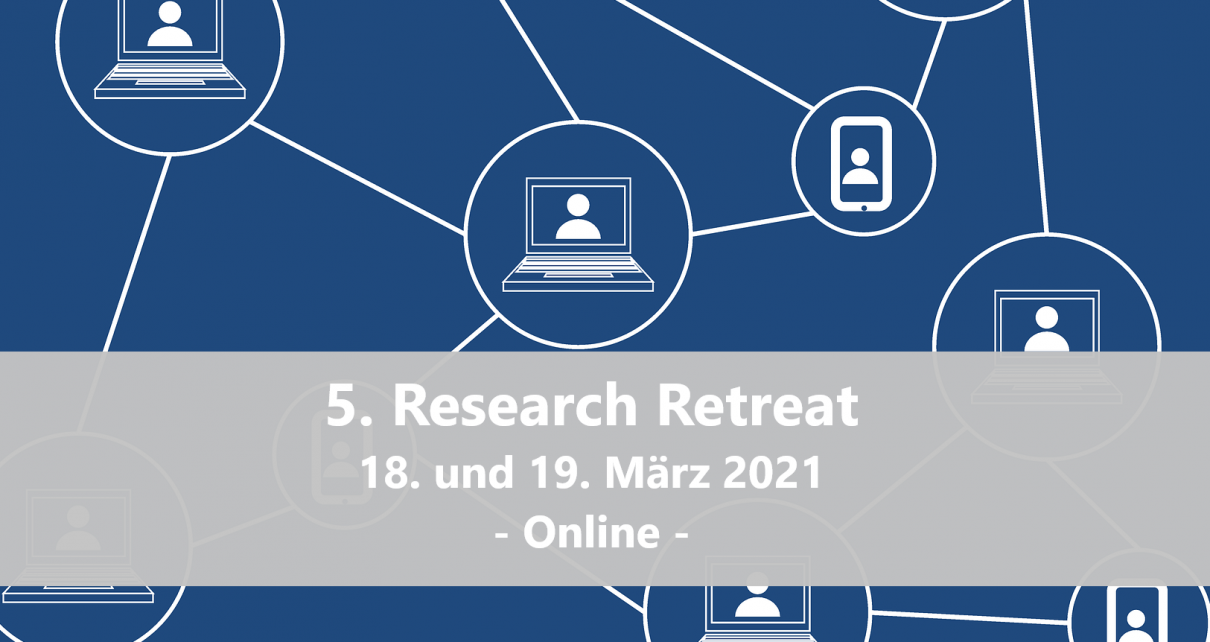Prof. Dr. Simon Munzert (Hertie School)
Anke Stoll (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
Jun.-Prof. Dr. Marc Ziegele (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
Prof. Dr. Lena Frischlich (Universität Münster, Ludwigs-Maximilians-Universität München)
Prof. Dr. Otfried Jarren (Universität Zürich, Freie Universität Berlin)
Prof. Dr. Stefan Evert (Universität Erlangen-Nürnberg)
Prof. Dr. Pascal Bastian (Universität Koblenz-Landau)
Prof. Dr. Stefan Böschen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen)
Jun.-Prof. Dr. Laura Hoffmann (Ruhr-Universität Bochum)